Der folgende Blogpost ist ursprünglich entstanden im Rahmen eines Schreibwettbewerbs anlässlich des 9. Todestages von Robert Enke. Ich möchte Euch im Nachgang des Wettbewerbs an meinen Gedanken gerne teilhaben lassen. Der an Depressionen erkrankte Fußballtorwart wählte am 10. November 2009 den Freitod.
Als ich in der Haustür stehe, rinnen mir die Tränen unaufhaltsam. Ich sacke in den Armen meiner besten Freundin zusammen. Das unaufhörliche Grau in meinem Kopf drückt mich nicht nur sinnbildlich nieder. Ich muss knien, kann mich nicht auf den Füßen halten. Es scheint, als entleere sich ein giftiger Cocktail aus Schmerz, Trauer, Selbsthass und Versagensängsten in meiner Seele – alles gleichzeitig in einem reisenden Tsunami aus überbordenden Gefühlen, der sämtliche Lebenslust niederknüppelt. Die Verzweiflung lähmt mich, macht mich handlungsunfähig.
Das war 2007. Zwei Jahre bevor Torhüter Robert Enke seine Last nicht mehr tragen konnte.
Die Nachricht von seinem Tod fuhr mir durchs Mark. Zwar hatte ich Robert Enke nie persönlich getroffen, dennoch spürte ich eine außergewöhnliche Verbindung und damit einen Moment unsäglicher Trauer nach der Nachricht seines Todes. Robert Enke stand als Profitorwart im Fokus der Öffentlichkeit und somit auch in meiner Wahrnehmung. Aber das war es nicht, dass die Verbindung zu ihm als Person schaffte. Sondern weil ich sie aus eigener Erfahrung genau kannte, diese omnipräsenten Gedanken der Hoffnungs- und Ausweglosigkeit, die einen handlungsunfähig machen und die einem einfachste Routinen unter einem riesigen Energieeinsatz abringen. Und der Zwang, sich tagtäglich die Frage zu stellen, ob es sich lohnt, für sein eigenes Leben zu kämpfen.
Die Nachricht, dass Robert Enke den Kampf verloren hatte, war ein tiefemotionaler Moment für mich. Ich habe mich in all‘ den Jahren danach immer gefragt, wie die einsamen, dunklen Momente für ihn gewesen sein müssen. Hat er auch geweint? War die Last für ihn auch so schwer, dass er entkräftet zusammengesunken ist? Haben Freunde und Bekannte auch nicht hinter seine Fassade schauen können?
Als Robert Enke sich zu seiner Entscheidung gezwungen sah, wurde mir schlagartig bewusst, welches Glück ich in meiner akuten Depression hatte. Nachdem ich 2007 unter Tränen zusammensackte, wandte ich mich an eine psychologische Beratungsstelle und hatte binnen drei Wochen einen Platz in der Psychotherapie. Das gab mir Kraft und Stabilität, weiterzukämpfen. Wie ich heute weiß, war diese schnelle Hilfe ein bürokratischer Ausnahmefall und möglicherweise der Rettungsanker, der mich heute diese Worte zu Papier bringen lässt.
Dieses Glück war es auch, dass mich antrieb, die Verbindung zu Robert Enke aufrechtzuhalten. Ich las das Buch „Robert Enke. Ein allzu kurzes Leben.“, hinterfragte den medialen Umgang mit Depressionen in einer wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere nachdem auch Schiedsrichter Babak Rafati die Krankheit erneut in die mediale Mitte brachte. Und als auch Fußballtrainer Sascha Lewandowski die Krankheit nicht mehr schultern konnte, outete ich mich in einem Zeitungsartikel unter Klarnamen und blogge seitdem auf Twitter und Facebook offen über meine Erfahrungen mit den Depressionen.
Und jedes Mal, wenn ich unter die mit dem Hashtag #notjustsad versehenen Artikel und Posts das Knöpfchen „Senden“ drücke, habe ich ihn wieder. Meinen ganz kleinen emotionalen und besonderen Moment mit Robert Enke. Denn ich weiß, dass das, was ich schreibe, ein kleines Mosaiksteinchen ist, das gesellschaftliche Tabu um Depressionen zu brechen. Aufzuklären. Ich spüre eine Lebendigkeit und eine besondere Kraft dabei. Diese möchte ich mit anderen Betroffenen, Angehörigen und Interessierten teilen. Diese Kraft und die Lebendigkeit, die ich Robert Enke von Herzen gewünscht hätte.
Titelfoto: Yülli/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Verwandte Blogeinträge
20. Mai 2018
Begegnungen — Neue Stolpersteine für Frankfurt
13. August 2017
Nachlese: Primary Structures
1 Comment
Add comment Antworten abbrechen
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.


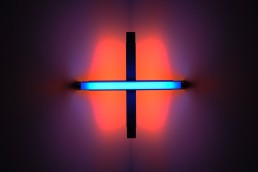

Hab einen Kloß im Hals…