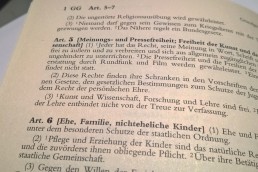Hörversion des Blogfeatures
Wenn man selbst Fotografierender ist, stellt sich häufig die Frage, wann eine Fotografie eigentlich zu Kunst wird. In anderen Worten: wann wird aus einem Foto ein Bild? Wenn es zu dieser Fragestellung kommt, dann darf die Betrachtung weder einheitlich noch eindimensional erfolgen. Zu sehr spielen Zeit und der mit ihr assoziierte Zeitgeist eine Rolle, eben genauso wie die technischen Möglichkeiten einer Epoche. Neben den klassischen Abgrenzungsmerkmalen zur bildenden Kunst, bietet die Fotografie noch etliche weitere Dimensionen: so zum Beispiel Perspektive, Brennweite, Standpunkt, Fokus, Format, Bearbeitung, Ästhetisierung, Entwicklung, Kolorierung, Retusche und viele andere mehr. In der Endabrechnung bleibt aber die Frage: wann ist eine Fotografie ein Foto, wann ein Bild?
Kaum eine andere Kunstform unterlag einem größeren Paradigmenwechsel im letzten Jahrhundert als die Fotografie. Genau um diesen Wandel hin zur Kunstform darzustellen, widmet das Städel Museum Frankfurt der Fotografie eine umfassende Überblicksausstellung unter dem Titel „Fotografien werden Bilder“. Thematisch ist sie an der sogenannten „Becher-Klasse“ aufgehängt. 1976 wurde Bernd Becher auf die erste Fotografie-Professur an der Düsseldorfer Kunstakademie berufen, wo er in enger Zusammenarbeit mit seiner Frau Hilla unterrichtete. In der ersten „Becher-Klasse“ studierten allesamt Künstler, die die Fotografie in den 80ern und 90ern prägen sollten. Ihre Namen lesen sich heute wie ein Ausschnitt eines Who-is-who deutscher Nachkriegsfotografie: Volker Döhne, Andreas Gursky, Candida Höfer, Axel Hütte, Tata Ronkholz, Thomas Ruff, Jörg Sasse, Thomas Struth und Petra Wunderlich.
Ausstellungsfilm des Städel Museums Frankfurt
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video sehen zu können. Wenn Sie dies akzeptieren, sehen Sie Videomaterial von YouTube, einem Drittdienstleister.
Wenn Sie dies akzeptieren, wird Ihre Einstellung gesichert und die Website neu geladen.
Allein die namhafte Besetzung der Ausstellung lockt also Kunst- und Fotografiefreunde in die von Dr. Martin Engler und seiner Ko-Kuratorin Dr. Jana Baumann zusammengestellte Ausstellung. Aber kann die Ausstellung die Vorschusslorbeeren halten? Ein Selbstversuch.
Mein Besuch in „Fotografien werden Bilder“
Brütende fünfundreißig Grad schwülwarmer Hitze. Die eigene digitale Spiegelreflexkamera, die mittels Tragegurt am Hals baumelt, zieht den Körper in eine unnatürliche, buckelige Haltung. Meine Kamera ist immer bei mir: das hat Tradition. Der prächtige Gebäudekomplex des Städels flimmert leicht im Antlitz der Temperaturen. Ich mache einige Aufnahmen. Vielleicht werden die ja auch mal zur Kunst? Ich bemerke ein schwarzes Schild am Zaun des Museums und werde stutzig. Auf ihm wird auf ein Digitorial hingewiesen. „becherklasse.staedelmuseum.de“, die multimediale Vorbereitung zur Ausstellung sei unter dieser Adresse im Internet zu finden.
Vorbereitung? Digitorial? Habe ich meine Hausaufgaben für meinen Museumsbesuch nicht gemacht? Zugegeben, ich bin weder ein Kunsthistoriker, noch Kunstwissenschaftler oder gar Künstler selbst. Wahrscheinlich rechtfertigte schon dieser Fakt, dass ich mich besser hätte vorbereiten sollen. Aber reicht heute nicht mehr ein einfacher Museumsbesuch? Mich beschleicht das Gefühl, dass ich den Kern der vor mir liegenden Ausstellung vielleicht nicht richtig verstehen werde. Und tatsächlich: mein Gefühl sollte mich nicht gänzlich im Stich lassen.
Im Museum angekommen genieße ich die wohltemperierten Räumlichkeiten. Als selbst Fotografierender zieht es mich am stadtweit bekannten Goethe-Bild von Tischbein vorbei direkt in die Sonderausstellung. In der Rotunde inspiziere ich die vielen Zeitleisten. Die Neugier zieht mich aber gleich weiter in die ersten beiden Räume der Ausstellung.
Werke von Bernd Becher und seiner Frau Hilla sind zu sehen. Typologien, Ansammlungen von Tableaus. Mal drei, mal neun, mal zwölf Fotos. Kohlesilos, Fachwerkhäuser, Tunneleinfahrten und Geschäfte. Alle in schwarz-weiß. Alle zumeist mit neutralem Hintergrund. Auf das Einfangen des Himmels wurde zumeist verzichtet. Schlichte Gebäude, reine Motive in ihrer gesamtkomplexen Wahrnehmung. Fördertürme, Hochöfen, Gasometer. Schlichte Industriekultur.
Ich fange an zu zweifeln. Das ist also Kunst? Das sind Bilder und keine Fotos? Aus heutiger Sicht betrachtet, technisch einfach umzusetzen. Ich selbst könnte das sogar auch. Geschlossene Blende, längere Belichtungszeit, das Gebäude wird so in seiner gesamten Ausprägung knackig scharf, der Himmel — leicht überbelichtet — wird so einfarbig hell. Schwarz-weiß-Filter, fertig. Hätte ich dann aber Kunst produziert und keine Fotos? Sind es die Serien, die Typologien, die aus diesen Fotos Kunst machen?
Ein Foto sticht heraus. Gutehoffnungshütte heißt es. Also das Gebäude. Aufgenommen 1963 in Oberhausen. Es zeigt im Vordergrund Wasseraufbereitungsbecken und im zentralen Mittelpunkt des Bildes ein groteskes Gebäude, eine Ansammlung von Röhren und Silos, von Fördertürmen und Schornsteinen, alles in einem einzigen industriellen Geflecht. Ich kann das wuchtige Gebäude nicht im Gesamten verstehen, muss hin und her springen, nach vorne und nach hinten wippen, um jedes Detail zu erfassen. Das könnte tatsächlich Kunst sein, denke ich mir.
Es geht weiter zu bunten Portraitfotos, die surreal wirken. Wie als ob man Passfotos angefertigt hätte, die man wie eine Produktfotografie nachkoloriert hätte. Daneben bunte Autos. Volker Döhne hat sie in seiner Serie „Bunt“ gemacht. Sie kombinieren laut Begleittext die soziale Fallhöhe zwischen Wirtschaftswunder und Nachkriegs-Tristesse. Die Fotos ziehen mich an. Sie wirken auf mich wie Pop-Art in einem Alltagsgrau, wie ein Widerspruch aus der gespielten Freude eines Versandhauskataloges gepaart mit dem unendlichen Grau der Urbanität.
Je tiefer ich in die Ausstellung vordringe, desto mehr entdecke ich Fotos, die mich in den schier grenzenlosen Formalismus der „Becher-Klasse“ ziehen. So auch die Projektionen von Candida Höfers Serie „Türken in Deutschland“ aus 1979. Obwohl fast vierzig Jahre alt, zeigen sie einen kulturellen Mikrokosmos, der an Aktualität wenig bis gar nichts eingebüßt hat. Ich bleibe bei den Aufnahmen der Künstlerin hängen, bewundere die riesigen leeren Lesesäle, die eine unfassbare Würde bei bestechender Bildtiefe aufweisen. Die Verbindung zum Stile der Bechers kann sogar ich jetzt ziehen.
Treppe rauf. Teil 2 der Ausstellung lenkt meinen Blick auf ein brachiales Bild. Andreas Gurskys „Paris, Montparnasse“, 1993. Ein Bild einer Wohnblockfassade. Nicht zu Unrecht kommt das Wort „Wohnghetto“ in meinem Kopf auf. Das Bild ist über vier Meter breit. Es ist bunt und doch irgendwie trist und grau. Es ist vollgepackt mit Details und doch erstaunlich aufgeräumt. Es ist abstrakt, es wirkt gerastert, symmetrisch glatt, aber doch nicht zu erfassen. Auch nicht, wenn man es aus mehreren Metern Betrachtungsabstand ansieht.
Der obere Ausstellungsteil spielt mit der Wahrnehmung. Die Künstler sind im Zeitalter der digitalen Bildbearbeitung angekommen, man könnte auch sagen, in der Epoche der Bildmanipulation, der Verfremdung. Es sind teilweise irritierende Bilder. Manche sind neblig, manche naturgrün, manche so verfremdet, dass die Perspektiven kopfstehen, zumindest glaube ich das, zu erkennen. Manche sind bis auf den groben Bildpunkt verfälscht, abstrakt und mit zurückgelassenen Spuren der Bearbeitung. Räumlichkeiten gehen verloren, Wirklichkeit auch. Bei manchen Werken ist gerade die Realität so illuster, dass die Motive gestellt wirken durch die bestechende Symmetrie und Klarheit der Bildsprache. Bei einigen Bildern fallen und kippen die eigentlich natürlichen Kanten und Gebäudewände ins Unermessliche. So könnte ich selbst gar nie fotografieren, würde es mein Empfinden für die grundlegenden Fotografietechniken und optisch-ästhetischen Grundregeln verhöhnen.
Zum Abschluss der Ausstellung schaue ich noch einmal in einen Holzkasten, in den zum Prisma geformte Glasscheiben eine Fotografie spiegeln. Was mir das sagen soll, weiß ich nicht. Ausnahmsweise fehlt hier ein Begleittext. Wie sonst eigentlich nie in der Ausstellung. Wahrscheinlich ist das aber die Abstrafung für meine mangelnde Vorbereitung, denke ich mir. Der Denkzettel dafür, dass ich das Digitorial nicht durchgearbeitet habe. Da hätte ich vielleicht herausgefunden, warum ich meine Nase an diesen Spiegel-Prisma-Glaskasten hätte halten sollen.
Das Fazit
Die Ausstellung hat mich aufgewühlt. Als ich durchgeschwitzt in der U-Bahn sitze, bin ich mir unschlüssig, ob ich die gesuchte Definition gefunden habe. Ob ich nun unterscheiden kann und darf, was Fotografie ist und was Bilder sind? Was ist Kunst? Was bricht die Grenzen zur Kunst auf? Was ist einfach nur schlichte Zeitgeist-Fotografie? Ich finde keine Antwort. Zumindest keine spontane.
Auch weil ich glaube, dass viele der Bilder, die ich in der Städel-Ausstellung gesehen hatte, heutzutage auf Instagram nur wenig Likes bekommen würden. Sie wären auf Flickr oder der Fotocommunity eher unauffällig. Einige Bilder wirkten auf mich technisch so unglaublich unsauber, dass ich als Digitalfotografierender sofort die Löschtaste betätigt hätte — ohne Umschweife. Der Zeitgeist heute käme den Fotos nicht gerecht.
Aber damals? Vor dreißig, vierzig Jahren? Als noch auf einen Klick fotografiert wurde? Mit Kameras, die ganz ungeniert jeden Unfug, den man aufnahm, auf teuren Agfacolor-Film packten und so für die Nachwelt aufbewahrten? Als man noch keine dreißigtausend Auslösungen pro Jahr machte? Muss man die Werke nicht unter dieser Prämisse betrachten?
Einen Tag später. Ich schaue mir die Aufnahmen an, die ich in der Ausstellung gemacht hatte. Die Motive sind noch so lebendig in meinen Kopf eingebrannt, dass ich das Gefühl nicht loswerde, immer noch im klimaanlagengekühlten Ausstellungsraum vor den Werken zu stehen. Ich tippe die Internetadresse für das Digitorial ein. Ich gebe mich mit der subjektiv empfundenen Lücke, die die Ausstellung in meine Seele geschlagen hat, nicht zufrieden. Ich arbeite das Digitorial durch und komme quasi so meiner Verpflichtung nach, die fälligen Hausaufgaben zu erledigen.
Und das kann ich jedem nur empfehlen. Denn wer die begleitenden Texte liest, die hervorragend aufgearbeiteten Videoszenen zur Ausstellung betrachtet und mit Abstand das ein oder andere Bild — und ich sage jetzt bewusst Bild — Revue passieren lässt, dem erschließt sich der wahre Kontext dieser Ausstellung und die Verbindungen der „Becher-Klasse“ zu ihren Mentoren.
Wer so wie ich lediglich kunst- und fotografieinteressiert ist, für den ist eine Einordnung der Bilder stark empfohlen. Nehmen Sie sich die Zeit für das Digitorial, sie lohnt sich sehr! Andernfalls besteht die Gefahr, die Qualität der Werke fehlzuinterpretieren oder gar von der Zusammenstellung der Ausstellung enttäuscht zu werden.
Unter der Prämisse eines Grundverständnisses über die Ausstellung (oder äquivalent dazu über Kunst und seine Ausprägungen im Allgemeinen) lässt sich festhalten, dass die Komposition der Ausstellung „Fotografien werden Bilder — die Becher-Klasse“ sehr gut gelungen ist. Die Ausstellung erzeugt einen komplexen Zusammenhang zwischen den neun Studenten der „Becher-Klasse“ mit ihrem jahrzehntelangen Wirken in den Fußstapfen ihrer Mentoren und der ursprünglichen Befreiung der Fotografie durch Hilla und Bernd Becher in den Endsechzigern, die eine Schnittmenge zwischen Fotokunst, Minimal Art und Konzeptkunst erzeugten.
Die Antwort, ob alle ausgestellten Werke Bilder oder Fotografien sind, liegt dabei wie so oft im Auge des Betrachters. Die von mir erhoffte, klare Definitionsgrenze zwischen Fotografie und künstlerischem Bild verschwimmt mit dem Auseinandersetzen mit dieser Ausstellung. Dabei darf vermutet werden, dass dies der beabsichtigte Denkanstoß des Kuratoriums gewesen sein dürfte. Diese Herausforderung sollten sowohl Kunstinsider als auch Fotografiebegeisterte unbedingt wahrnehmen.
Die Ausstellung „Fotografien werden Bilder — die Becher-Klasse“ ist noch bis zum 13. August 2017 im Städel Museum Frankfurt zu sehen.
Informationen zur Ausstellung und Online-Tickets, Digitorial.
Verwandte Blogeinträge
1. Juli 2017
60 Jahre Bundesbank
26. Juni 2017
150 Jahre Polizei Frankfurt
15. April 2016